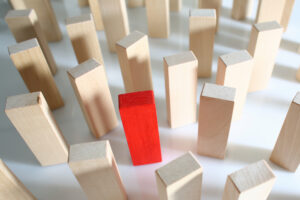Änderung des Vereinszwecks: Was ist möglich und welche Mehrheit ist erforderlich?

Thema: Vereinsrecht
- Vereinsgründung
- Änderung des Vereinszwecks
- Satzung
- Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen
- Buchhaltung im Verein
- Organe eines Vereins
- Vorstand und Vorstandswahl
- Mitgliederversammlung
- Dachverband und Gesamtverein
- Der nicht eingetragene Verein
- Das Transparenzregister
- Die E-Rechnung
- Mutterschutz und Elternzeit
- Ausschluss eines Mitglieds
- Auflösung und Liquidation
Vereine entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter. Manchmal sollen neue Aktivitäten in die Satzung aufgenommen oder bestehende angepasst werden. Doch wann handelt es sich dabei um einfache Satzungsänderungen – etwa eine geänderte Maßnahme zur Zweckverwirklichung – und wann um eine echte Zweckänderung mit strengeren Vorgaben?
Was ist unter „Zweck“ und „Zweckverwirklichungsmaßnahme“ zu verstehen?
Der Vereinszweck ist der in der Satzung festgelegte oberste Leitsatz der Vereinstätigkeit – gewissermaßen der Grund, weshalb sich die Mitglieder überhaupt zusammenschließen. Bei einem gemeinnützigen Verein muss sich hier (mindestens) ein steuerbegünstigter Zweck finden.
Alle Aktivitäten des Vereins sollen diesem Zweck dienen – sie werden als Zweckverwirklichungsmaßnahmen bezeichnet und sind die konkreten Mittel und Wege, wie der Zweck erreicht wird. Oft findet sich in der Satzung ein Absatz wie „Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch …“, gefolgt von beispielhaften Tätigkeiten.
Beispiele:
- Hat ein Umweltverein den Zweck „Förderung des Naturschutzes“, so können Zweckverwirklichungsmaßnahmen z.B. Pflanzaktionen oder Bildungsarbeit sein.
- Bei einem Sportverein (mit dem Zweck „Förderung des Sports“) könnten Zweckverwirklichungsmaßnahmen das Betreiben bestimmter Sportstätten, die Ausrichtung von Turnieren oder Trainingsangebote für Jugendliche sein.
Änderungen in diesen Bereichen betreffen also unterschiedliche Ebenen: Ändere ich das Endziel (den Zweck) oder lediglich den Weg dorthin (die Maßnahmen)? Von dieser Unterscheidung hängt ab, welche rechtlichen Hürden im Fall einer Änderung zu nehmen sind.
Zweckänderung: Strenge Vorgaben für die Änderung des Vereinszwecks
Eine Änderung des Vereinszwecks im rechtlichen Sinne stellt eine Wesensänderung des Vereins dar. Hierbei wird quasi die Identität des Vereins ausgetauscht. Gesetzlich greift in diesem Fall § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB: Für eine Zweckänderung ist die Zustimmung aller Vereinsmitglieder erforderlich, nicht nur der anwesenden Mitglieder. Das bedeutet, dass auch alle nicht bei der Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder schriftlich zustimmen müssen. Ohne Einstimmigkeit geht es nicht – eine Enthaltung oder Gegenstimme lässt die Zweckänderung scheitern.
Wichtig zu wissen: Die Vereinssatzung kann zwar andere Mehrheitserfordernisse festlegen (z.B. 2/3-Mehrheit für Satzungsänderungen). Für die Zweckänderung selbst darf aber kein zu lasches Quorum vorgesehen werden, sonst würde die gesetzliche Schutzregel umgangen. Selbst wenn man in der Satzung zukünftig ein niedrigeres Quorum für Zweckänderungen einführen will, müssen alle Mitglieder dieser Satzungsänderung zustimmen.
Eine echte Zweckänderung liegt aber nur vor, wenn der oberste Vereinszweck so geändert wird, dass der Verein einen völlig anderen Charakter erhält, mit dem kein Mitglied bei seinem Beitritt rechnen konnte.
Fälle einer Zweckänderung wären daher:
- Der Verein soll einen völlig neuen Zweck bekommen, der mit dem ursprünglichen nichts mehr zu tun hat (z.B. aus einem Kunstverein soll ein Sportverein werden).
- Zum bestehenden Zweck soll ein weiterer, unabhängiger Hauptzweck hinzugefügt werden (z.B. ein reiner Schulförderverein möchte zusätzlich Förderung des Umweltschutzes als Zweck aufnehmen).
- Der bisherige Zweck wird so stark umdefiniert oder ersetzt, dass die ursprüngliche Leitidee nicht mehr erkennbar ist.
In all diesen Fällen hatten die Mitglieder beim Beitritt diese inhaltliche Ausrichtung nicht erwartet – die Beitrittserklärung deckt den neuen Zweck nicht mehr. Deshalb räumt das Gesetz jedem Mitglied ein Vetorecht ein: Wer mit der neuen Ausrichtung nicht einverstanden ist, kann den Wechsel durch Verweigerung der Zustimmung verhindern.
Rechtsfolgen einer fehlenden Zustimmung: Wird eine echte Zweckänderung nicht nach den Vorgaben des § 33 BGB beschlossen, ist der Beschluss nichtig. Die Satzungsänderung kann dann nicht ins Vereinsregister eingetragen werden. Selbst wenn das Register es versehentlich einträgt, wäre die Änderung unwirksam. Im schlimmsten Fall steht der Verein ohne gültige Satzung da oder handelt jahrelang auf falscher Grundlage. Auch die Gemeinnützigkeit kann gefährdet sein, wenn der tatsächlich gelebte Vereinszweck von dem in der Satzung niedergelegten Zweck abweicht.
Da die Hürde einer Zweckänderung so hoch ist, sollte sorgfältig geprüft werden, ob wirklich der Kernzweckgeändert werden muss. Oft lässt sich das Vereinsziel auch ohne formalen Zweckwechsel erreichen. Für größere Vereine mit vielen Mitgliedern wird es sonst meist unmöglich sein, die erforderliche Einstimmigkeit herbeizuführen.
Änderung von Zweckverwirklichungsmaßnahmen: Flexible Anpassung innerhalb des bestehenden Zwecks
Im Gegensatz zur echten Zweckänderung sind Änderungen bei den Zweckverwirklichungsmaßnahmendeutlich einfacher umzusetzen. Hier bleibt der oberste Zweck unverändert – es werden lediglich die Wege zum Zweck angepasst. Keine Zweckänderung liegt vor, wenn „lediglich die Ziele des Vereins unter Beibehaltung der Leitidee dem Wandel der Zeit angepasst oder andere Mittel zur Zweckerreichung gewählt werden“. Mit anderen Worten: Solange die Leitidee und der Charakter des Vereins erhalten bleiben, kann man die Ausgestaltung relativ frei ändern.
Solche Änderungen gelten rechtlich als normale Satzungsänderungen. Das bedeutet: Es reicht die in der Satzung vorgesehene Satzungsänderungs-Mehrheit (häufig z.B. 2/3 der abgegebenen Stimmen, vgl. § 33 Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. der jeweiligen Satzung). Eine Zustimmung aller Mitglieder ist nicht erforderlich. Der Beschluss wird – wenn ordnungsgemäß angekündigt und mit nötiger Mehrheit gefasst – durch Eintragung in das Vereinsregister wirksam.
Beispiele für (bloße) Zweckverwirklichungsmaßnahmen:
- Ein Kulturverein, der bisher Konzerte veranstaltete, möchte nun auch Theateraufführungen organisieren. Der Zweck „Förderung von Kunst und Kultur“ bleibt unverändert – man erweitert nur die Mittel, um diesen Zweck zu erreichen.
- Ein Tierschutzverein ändert seine Strategie: Statt wie bisher vor allem politische Arbeit zu leisten, will er nun Tierpatenschaften und Aufklärungsarbeit an Schulen fördern. Solange der Zweck (Tierschutz) gleich bleibt, sind das nur geänderte Maßnahmen zur Zweckerfüllung.
- Der Sportverein „XYZ e.V.“ hatte in der Satzung stehen, dass der Zweck durch „Betrieb eines Fußball- und Tennisclubs“ verwirklicht wird. Künftig sollen auch Jugendcamps und E-Sport-Turniere dazugehören. Diese neuen Angebote dienen weiterhin der Förderung des Sports – also keine Zweckänderung, sondern eine Ausweitung der Aktivitäten.
Wichtig: Auch wenn für solche Änderungen nicht alle Mitglieder zustimmen müssen, gelten die allgemeinen Anforderungen für Satzungsänderungen: Die geplante Änderung muss in der Einladung zur Mitgliederversammlung angekündigt werden (idealerweise mit Gegenüberstellung alter und neuer Fassung) und die Formulierung sollte genau geprüft werden. Schließlich entscheidet das Registergericht, ob wirklich nur eine Maßnahme geändert wurde oder in Wahrheit der Zweck betroffen ist. Im Zweifel interpretiert das Gericht eher streng – daher klare Formulierungen wählen und notfalls den Zweckpassus unverändert lassen.
Fazit
Die Abgrenzung zwischen echter Zweckänderung und bloßer Änderung der Zweckverwirklichungsmaßnahmen ist in der Praxis allerdings häufig schwierig. Rechtsprechung und Literatur sind sich jedenfalls einig: Es gibt keine allgemeingültigen Abgrenzungskriterien, vielmehr ist stets der konkrete Verein hinsichtlich Satzung und Vereinsrealität im Einzelfall zu betrachten.